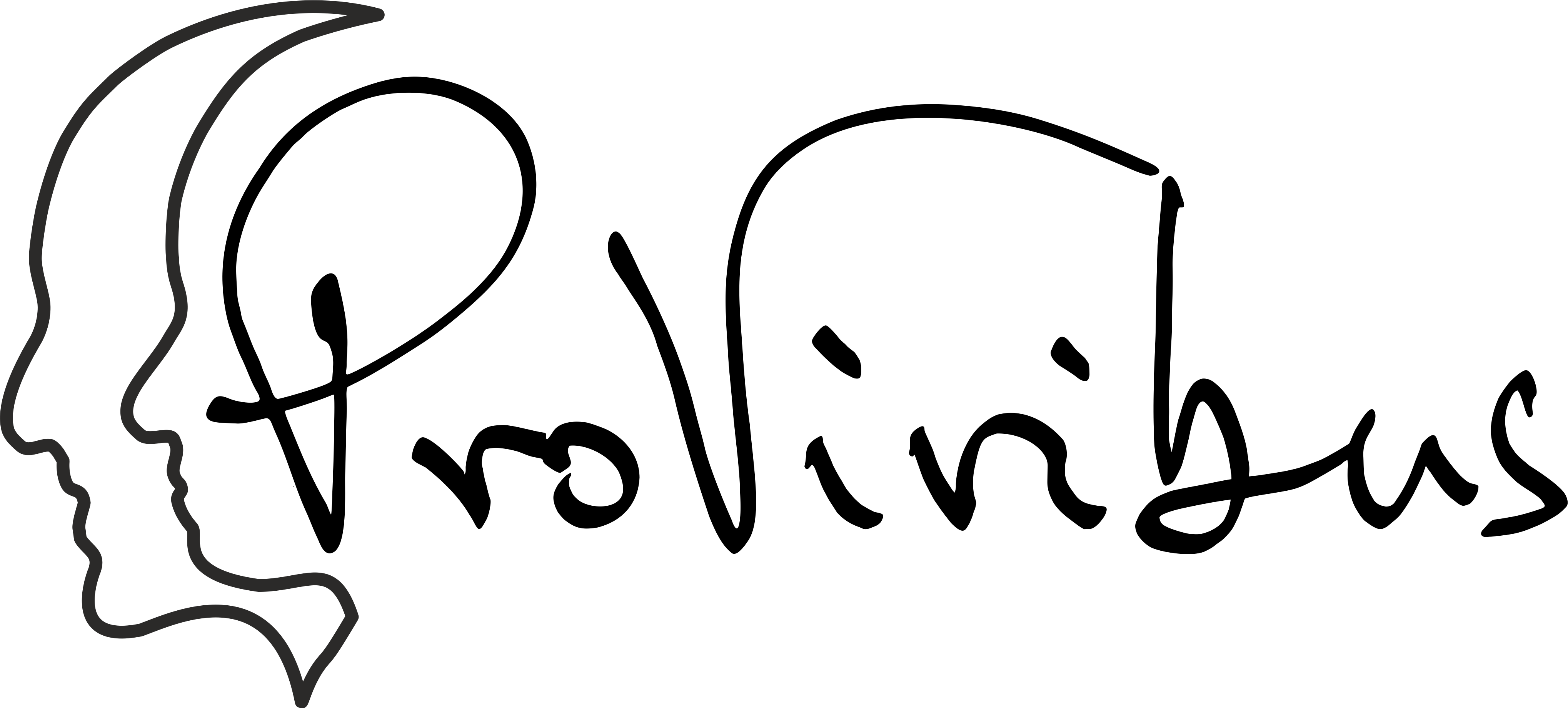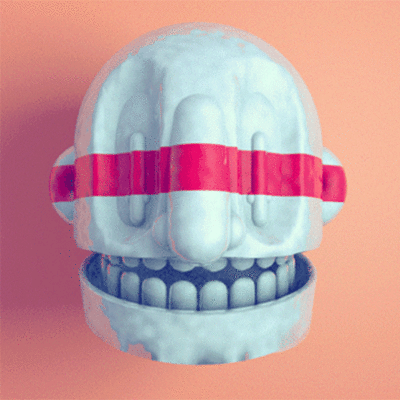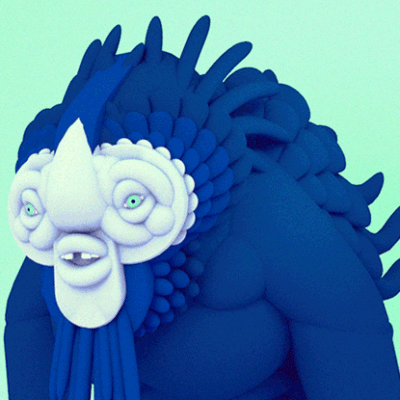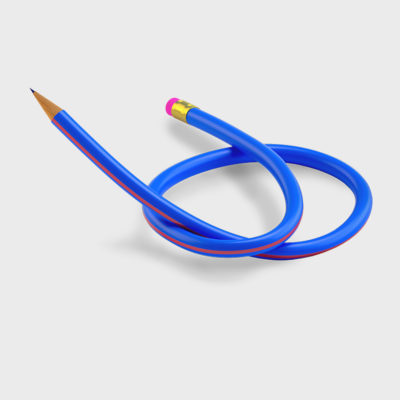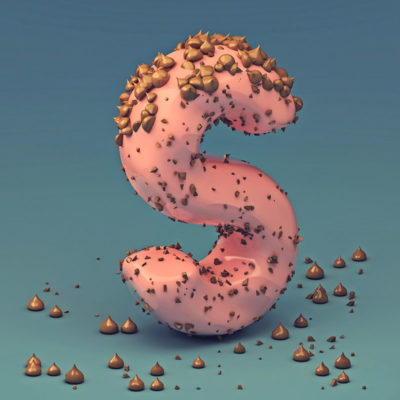Das Kennenlernen — Stimmt die Chemie?
Sie können uns über verschiedene Kanäle erreichen (folgende Möglichkeiten gibt es). In einem unverbindlichen und kostenlosen Erstgespräch können Sie ihr Anliegen schildern und wir besprechen gemeinsam eine denkbare Vorgehensweise. Wenn Sie sich bei uns wohl und verstanden fühlen, vereinbaren wir zeitnah einen Termin für den Therapiebeginn.
Die Therapie — Erkennen, Angehen, Verändern, Reflektieren
Sie haben erkannt, dass irgendetwas nicht im stimmig ist, irgendetwas Ihre Lebensqualität mindert, vielleicht der Job nicht mehr die Berufung darstellt, die es mal war. Mit der Erkenntnis geht der Wunsch nach Veränderung einher. Hier können wir anknüpfen und versuchen gemeinsam einen neuen Weg zu finden.
Grundsätzlich gilt: Wir können Ihnen kein Allheilmittel für Ihre Probleme garantieren, aber wir können Ihnen helfen, Ihre Probleme besser zu verstehen und Strategien zur Lösung zu entwickeln. Wir können Sie auf diesem Weg begleiten und Alternativen aufzeigen. Hier sind Sie jetzt gefragt: Ihre Aufgabe ist es, den Weg selbstständig zu beschreiten und stets aktiv an sich zu arbeiten. Wir stehen Ihnen beratend zur Seite und bieten eine helfende Hand. Abschließend reflektieren wir den Prozess und besprechen das Ergebnis.
Mustererkennung
Die Mustererkennung ist vergleichbar mit einem komplexen Mosaik. Die Betrachtung des Menschen in seiner Ganzheitlichkeit, mit allen individuellen Stärken und Schwächen und die Verknüpfung der gewonnen Informationen aus den verschiedenen Therapieformen, ermöglicht ein breitgefächertes Spektrum (u. a. biografische Einflüsse, berufliche Orientierung, Schicksalsschläge) zur Erforschung der eigenen Psyche. Das Analysieren und Kombinieren der Informationen und die sukzessive Ergänzung der Inhalte erlaubt eine individuelle Betrachtung. Das Zusammenspiel von Psychoanalyse und Verhaltenstherapie kann einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, sich selbst besser kennenzulernen, individuelle Muster zu bewerten und die seelischen Bedürfnisse besser adressieren zu können. Dieses Bewusstsein und die damit einhergehenden Veränderungen lassen sich nicht erzwingen, sie brauchen Zeit und müssen vom inneren Ich akzeptiert werden.
Verhaltenstherapie
Die klassische Therapieform gliedert sich in die Punkte: Kennenlernen, Anamnese, Therapie und Nachsorge.
Die Verhaltenstherapie orientiert sich daran, individuell belastende, oder als störend empfundene Verhaltensweisen, Gefühle oder Gedanken aufzugreifen und gezielt zu verändern. Persönlichkeitsmerkmale entwickeln und etablieren sich bereits im Kleinkindalter und festigen sich über die Zeit bzw. werden in aktuellen Situationen immer wieder abgerufen. Sei es das Verhalten im Beisein von Freunden, Familienmitgliedern oder Kollegen, die Reaktion auf besondere Ereignisse (freudige wie traurige), Verlustängste, Kränkungen oder Schuldgefühle, um nur einige wenige Aspekte zu benennen. Die Psyche versucht, je nach Situation, auf bereits bekannte Muster zurückzugreifen, was bis zu einem gewissen Grad auch funktional ist, aber langfristig zu psychosomatischen Reaktionen führen kann. Zu beachten ist hierbei, dass eine Änderung im Verhalten stets mit der Selbsterkenntnis bzw. dem eigenen Wunsch nach Veränderung einhergeht. Ein von außen auferlegter „Wunsch“ ist schwerer zu verwirklichen, da es (noch) nicht im Inneren verankert ist. Des Weiteren ist jede Veränderung mit einer großen Herausforderung verbunden, da es bereits gefestigte Verhaltensweisen neu zu justieren bzw. zu ersetzen gilt. Auch hier gilt es die persönliche Komfortzone zu verlassen, aufgebaute Schutzbarrieren zu überwinden und sich auf neue Wege zu begeben. Wissenschaftlich betrachtet ist das Erlernen neuer Verhaltensweisen vergleichbar mit dem komplexen, lebenslangen Lernprozess. Jeder von uns hat ein individuelles Netzwerk aus neuronalen Verschaltungen und kann unterschiedlich schnell Neues erlernen.
Die Verhaltenstherapie unterscheidet sich von der Psychoanalyse dahingehend, dass sie sich mehr auf den Ist-Zustand begrenzt und weniger den tief in den biografischen Hintergrund einsteigt. Es geht zunächst darum, (Problem-) Lösungsstrategien zu entwickeln und erlernte Muster umzustrukturieren.
Psychoanalyse
Die klassische Therapieform gliedert sich in die Punkte: Kennenlernen, Anamnese, Therapie und Nachsorge.
Die „Behandlung der Seele“ zielt auf das Denken, Handeln und Erleben einer Persönlichkeit ab. Ihre Analyse ist dagegen mit einem Rätsel vergleichbar, dass zunächst entschlüsselt werden möchte, bevor es verstanden werden kann. Hinter der Fassade bestimmter Verhaltensweisen befinden sich oft unbewusste Bedeutungen, die dem eigenen Ich verborgen sind. Die Analyse dieser Verhaltensweisen und ihr Bewusstmachen erfordert Mut, Zeit und Geduld. Daher ist es nur natürlich, dass Veränderungen auf dieser Ebene einen längerfristigen Zeitraum in Anspruch nehmen und nicht kurzfristig erzwungen werden können.
Die Psychoanalyse unterscheidet sich von der Verhaltenstherapie durch die Schwerpunktsetzung der Ursachenfindung und der damit einhergehenden breitgefächerten Anamnese. Zentral ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie und dem gesellschaftlichen Umfeld (Peer-Group, familiäres und berufliches Umfeld). Aus dem daraus resultierenden Pool an Informationen kann ein individuelles Muster abgeleitet werden, dass für die weitere Therapie zentral ist. Die gewonnenen Erkenntnisse ergeben ein tiefergehendes Verständnis der eigenen Psyche und kann deshalb zu einer sukzessiven Verbesserung der Lebensqualität beitragen.
Bewerbungsmanagement / Coaching
Wir bieten Beratung im Bereich beruflicher Problemstellungen oder bei der Neuorientierung im Job an. Der Begriff „Coaching“ umfasst dabei u. a. die Förderung der persönlichen Kompetenzen, gerade in Führungspositionen, Analyse und Bewertung konfliktbehafteter Situationen sowie Stärkung des Selbstwertgefühls. Im Berufsleben steht zunehmend die Funktionalität des Arbeitnehmers im Vordergrund und bei manchen über die Zeit hinweg ihren Tribut. Der zunehmende Stress und Druck erzeugten ein Ungleichgewicht in der Work-Life-Balance, was sich längerfristig in psychischen Reaktionen (z. B. Erschöpfungszustände, psychosomatische Symptome, Burn-out) bemerkbar macht. Um dieser Situation vorzubeugen, muss man ein Bewusstsein für sich selbst und seinen Kräftevorrat haben. So trivial es klingt, dass jeder von uns nur nach seinen individuellen Kräften agieren kann, so schwierig ist es jedoch, dies in erster Linie auch zu akzeptieren. Die bedingungslose Aufforderung alles für den Job zu geben, seine Gesundheit bis an die Grenze auszureizen, Familie und Freunde zu vernachlässigen, sich selbst zu vernachlässigen und vor allem den Schein nach außen hin wahren, dass alles funktioniert, führt zu Belastungen, denen nicht jeder gewachsen ist. Wie ein Mensch auf diese zunehmende Umstrukturierung in der Arbeitswelt reagiert, hängt letztendlich von seiner Resilienz ab.
Sozialpädagogische- / soziale Arbeiten
Kern der Arbeit ist es Menschen in schwierigen sozialen wie persönlichen Situationen nicht mit Ablehnung und Vorurteilen zu begegnen, sondern sie zu unterstützen und zu begleiten. Dies geht einher mit der Aufgabe die aktuelle Lebenssituation zu analysieren und gemeinsam Wege für ein selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft zu definieren. Auch hier begründen sich einzelne Situationen aus erlernten Mustern, die sich über die Zeit manifestiert und (scheinbar) bewährt haben. Eine Notsituation oder schwierige Lebensverhältnisse können plötzlich auftreten, z. B. durch Arbeitslosigkeit, Scheidung, Erziehungskonflikte oder auch schulische Probleme. Die Ursachen für die aufgetretenen Probleme gilt es zu ergründen und Lösungsstrategien zu entwickeln. Diese Herangehensweise impliziert zudem eine Analyse des Verhaltens und zielt auf einen ganzheitlich ausgerichteten Lösungsansatz ab.
Problemlösestrategien / Krisenbewältigung
Problemlösestrategien sind ein Bestandteil der Verhaltenstherapie. Probleme können in unterschiedlichen Bereichen (z. B. Partnerschaft, Beruf, Familie, Freunde oder Gesundheit) auftreten. Sie zu erkennen, bearbeiten und zu lösen erscheint trivial, ist aber in der Umsetzung mit gewissen Herausforderungen verbunden. Zentral steht hier das problemlösende Denken, das mit einem Konzept und einem bestimmten zeitlichen Verlauf verbunden ist. Die Phasen umfassen das Identifizieren des Problems, die Ziel-/Situationsanalyse, Planerstellung und Ausführung, sowie die abschließende Bewertung. Aus den Erörterungen lässt sich ein individuelles Muster ableiten, dass für die betreffende Person charakteristisch ist. Hinterfragt werden muss zunächst die eigene Motivation und die Emotion, die mit der Erreichung des Ziels verbunden ist. Begleitet wird dies durch die Bewertung des Problems hinsichtlich seiner Komplexität und seiner zeitlichen Einordnung.